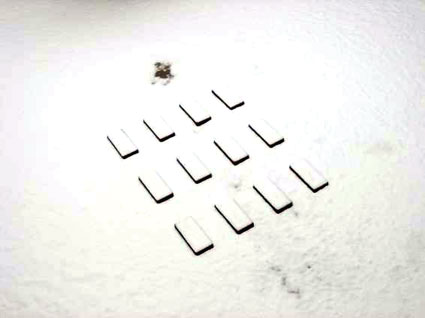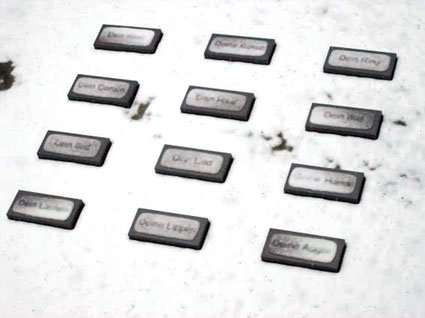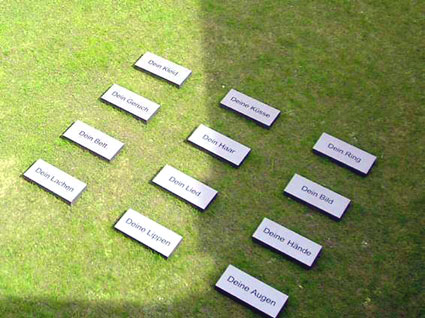|
"Dem Himmel
gegenüber"
Paul-Hofhaimer Tage, Radstadt, 11. Juni 2006
Vortrag Johannes Rauchenberger, Graz
Dem Himmel gegenüber
sehr geehrte Damen und Herren,
erzählt man sich Witze.
Ein solcher
sehr bekannter ist aufgeschrieben bei Ludwig Thoma, dem Redakteur des
„Simplicissimus“, geboren 1867 im schönen Bergdorf Oberammergau,
das der schönen Bergstadt Radstadt in zwei Punkten gleicht, in der
Schönheit ihrer Natur und, zweitens, in der hohen Emigrationsrate,
wenn gerade nichts zu tun ist – wie etwa die Passion zu spielen oder
die Paul-Hofhaimer Tage zu bestreiten inclusive Mozarts Requiem.
Die kurze Titelgeschichte der unter
der Überschrift „Der Münchner im Himmel“ versammelten „Satiren
und Humoresken“ erzählt von der Himmelfahrt des ,,Alois Hingerl,
Nr. 172, Dienstmann in München“, der „vom Schlag gerührt zu
Boden fiel und starb“.
Im Himmel wird er vom Hl. Petrus in
Empfang genommen. „Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit
der himmlischen Hausordnung bekannt. Von acht Uhr früh bis zwölf Uhr
mittags ,frohlocken', und von zwölf Uhr mittags bis acht Uhr abends
,Hosianna singen' .“ Der Münchner Dienstmann fügt sich, wenn auch
widerwillig, den neuen Existenzbedingungen, setzte sich, „wie es ihm
befohlen war, auf eine Wolke und began n zu frohlocken: ,Ha-lä-lä-lä-lu-u-hu-hiah!'
...“ Da es aber über
eine vage Manna-Verheißung hinaus bei all dem Frohlocken nichts zu
trinken oder zu schnupfen („koan Schmaizla“) gibt, schiebt sich in
das ätherische Alleluja ein handfestes Fluchen: „fing er wieder
sehr zornig zu singen an: „,Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh - - Himmi -
Herrgott - Erdöpfi - Saggerament - lu - uuu – iah!' Er schrie so,
daß der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz
erstaunt fragte: ,Was ist denn da für ein Lümmel heroben?'“
Gottvater wird wie ein gemächlicher bayrischer Dorfpfarrer unsanft
aus dem mittäglichen Schlummer geweckt, und wie einem solchen Gegenüber
spornt die Beschwerde über die himmlische Ruhestörung den Alois erst
recht zum Schimpfen an: ,,,Ja, was glaab'n denn Sie?' sagte er. ,Weil
Sie der liabe Good san, müaßt i singa, wia'r a Zeiserl, an ganz'n
Tag, und z'trinka kriagat ma gar nix! A Manna, hat der g'sagt, kriag
i! A Manna! Da balst ma net gehst mit dein Manna! Überhaupt sing i
nimma!'“ Der „liebe Gott“ und sein Himmelspförtner erkennen auf
Dienstuntauglichkeit für den himmlischen Chorgesang und setzen den
Alois in eine andere „englische“ Funktion um, eine Art himmlischen
Dienstmann, der „die göttlichen Ratschlüsse der bayrischen
Regierung“ überbringen soll, welcher praktische Dienst ihn mehr
freut als das Frohlocken zur Harfe. Sein erster Auftrag an den
bayrischen Kultusminister führt freilich gleich zu einer höchst
irdischen Reinkarnation: ,,Allein, nach seiner alten Gewohnheit ging
er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr von
Wehner wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung.“
Unter dem Titel „Der Postsekretär
im Himmel“ gibt es im gleichen Band eine zweite Geschichte, die,
weil ganz ähnlich, hier im einzelnen nicht nachzuerzählen ist. Die
Himmelsreise wird da „einem echt bayerischen Schlaganfall“
zugeschrieben, der sich am Ende aufklärt: „Da merkte er froh, dass
er im Bräuhause eingeschlafen war und alles nur geträumt hatte.“
Von solcher Seinsart wird auch die Himmelfahrt des Alois Hingerl
gewesen sein. Es sind Träume vom Himmel, aber eher Alpträume einer
jenseitigen Existenz, in der wahr würde, was Theologen vom Schlage
des Hl. Augustinus dem gemeinen Volk als Seligkeit vor Augen malen:
„cibus noster alleluia, potus alleluia. Totum gaudium est alleluia“
(Unser Essen ist ein Halleluja, unser Trinken ist ein Halleluja.
Unsere ganze Freude ist das Halleluja.)
also: sehr geehrte Damen und
Herren,
dem Himmel gegenüber,
… ist sicher ein Gasthaus oder
wenigstens eine Almhütte. Für alle, die warten bis sie hinüberkommen.
Oder, die einen trinken gehen als Unterbrechung zum ewigen
Hallelujasingen. Oder für die, die die zündenden Ideen des göttlichen
Ratschlusses für eine Stadt überbringen, sie sehen also, wie
politisch diese Paul-Hofhaimer Tage sind: „Um die Ecke, links,
geradeaus, links“ – dem Himmel gegenüber, das ist eine
Wegbeschreibung für einen besonderen Ort. Sind
es die Wolken? Ist es die Landschaft, sind es die Berge? Die Wiese,
das Grün, die Erde? Das
Dickicht der Städte?
Imagine,
there is no heaven above us, no hell below us, only sky. So sang John Lennon.
Einfach nur
sky? Aus Mozarts Feder hingegen erklingt heute Abend als Höhepunkt
dieser 20. Paul-Hofhaimer-Tage das Requiem mit seiner berühmten
Sequenz des „dies irae dies
illae“ am Abend. Also ist das Gegenüber des Himmels der Tag
des Zorn an jenem Tag, wie wir schön übersetzen? Und nicht: Unser
Trinken ist ein Halleluja, das Essen ist ein Halleluja, die ganze
Hetz’ ist ein Halleluja. Alles ist möglich.
Was aber ist das dies irae, dies illae, fragen wir schnell nach, denn wir kennen es
nicht mehr. Erlauben Sie eine kleine biografische Randnotiz: Als ich
geboren wurde, hat es die Kirche aus der Begräbnisliturgie
gestrichen. (Was natürlich nichts mit mir zu tun hat!)
Vielleicht haben wir es wenigstens
vom Deutschunterricht noch in Erinnerung. In der berühmten Dom-Szene
bei Goethes Faust, also in jener, der unmittelbar darauf die
Walpurgisnacht folgt, macht der Böse Geist dem Gretchen furchtbar
schlechtes Gewissen, so sehr, dass diese eh schon
geängstigte Frau zur schieren Verzweiflung getrieben wird.
Der Böse Geist beginnt dem
Gretchen einzuflößen:
„Wie anders, Gretchen, war dir’s,
Als du noch voll Unschuld
Hier zum Altar tratst,
Aus dem vergriffenen Büchelchen
Gebete lalltest,
Halb Kinderspiele,
Halb Gott im Herzen!
Gretchen!
Wo steht dein Kopf?
In deinem Herzen
Welche Missetat?
Betst du für deine Mutter Seele, die
Durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief?
Auf deiner Schwelle wessen Blut?
- Und unter deinem Herzen
Regt sich’s nicht quillend schon
Und ängstet dich und sich
Mit ahnungsvoller Gegenwart?
Gretchen: „Weh! Weh!
Wär ich der Gedanken los,
Die mir herüber und hinüber gehen
Wider mich!“
Chor: Dies irae dies illa
solvet saeclum in favilla
Orgelton
Der Böse Geist nutzt diese Verse
des dies irae dies illa zur
puren Einschüchterung. Und
so geht es weiter in dieser Szene bis sie kippt.
Der Chor fährt fort schließlich in den berühmten Versen:
Chor: „Quid
sum miser tunc dicturus“ –
Und Gretchen stammelt nur
mehr:
„Nachbarin! Euer Fläschchen! – „
Sie fällt in Ohnmacht
Ja, das Fläschchen! In der
Inszenierung, die Goethes Drama dem bildungsbürgerlichen Bewusstsein
einprägte, färbte sich der kirchliche Gesang zum Medium teuflischer
Beängstigung der Seele. Das maligne Spiel mit den liturgischen
Zitaten, welches Gretchen die Seele zusammenschnürt, überträgt sich
im Bildungsgang schließlich unter der Hand auf die Sequenz als solche
und ganze. So empfunden, konnte sie kaum Bestand haben und musste
irgendwann ins religionsgeschichtliche Depot, eingesperrt am besten,
zugeschnürt, versiegelt. Aber heute, bei Ihnen in Radstadt, wird sie
gesungen, die Sequenz.
Nehmen Sie also das Fläschchen
mit, wenn sie schon nicht im Hofbräuhaus sitzen!
Mal langsam.
Das dies
irae haben also die Liturgen der Kirche fast zeitgleich, als die
Beatles die Götter unserer Eltern waren, aus der offiziellen Begräbnis-Liturgie
entfernt – unzumutbar für heutige Ohren, wie man wahrscheinlich zu
Recht argumentierte. (So ist es das Konzert, das noch darf, was man
nicht mehr beten soll.) John Lennon hat nicht den heaven
besungen, sondern den sky.
Der ist zwar noch immer unendlich, wie uns die Kosmologen erzählen,
aber zumindest in unserer Nähe ziemlich verpestet, durch die
Treibgase, die die Erde erwärmen, das Gletscher schmelzen und die
Meere ansteigen lassen und so Millionen von Lebewesen, darunter auch
Menschen, unter sich begraben werden, durch die zahlreichen Luftstraßen,
mit denen wir in metallenen Gefängnissen, ziemlich beengt und
nebeneinander geschlichtet wie Sardinen, sodass wir nicht einmal
ordentlich die Zeitung lesen können ohne die Sitznachbarin zu stören,
einen einstigen Traum der Menschheit verwirklichen: sich zu erheben über
die Wolken, etwas schneller von einem Ort zum anderen zu kommen, es
gleichzutun den Vögeln.
Und wie wir da sitzen, im Flugzeug,
und vielleicht das Glück haben, beim kleinen Guckloch nicht den öden
Flügel zu sehen, sondern tatsächlich den Himmel, den nach oben
nichts mehr begrenzt, der sich nur abgrenzt von seinem buchstäblichen
Gegenüber, der flauschigen weißen Decke aus Wolken, sodass wir
glauben möchten, hineinfallen zu wollen in diese weiße Watte,
bekommen wir noch kurz einen Schauder, jenen Schauder, den wir beim
ersten Mal hatten, als wir ein Flugzeug bevölkerten, dass das
Hineinfallen in diese Watte, ja kein Fallen in einen weichen Flausch
bedeutet, sondern nur ein Durchfallen durch diese Decke, die ja nur
aus gesättigten Wassertropfen besteht, hinab, hinab, so, wie Hölderlin
in Hyperions Schicksalslied
dichtet „ins Ungewisse hinab.“
„Ihr wandelt droben im Licht / Auf weichen
Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht,
wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos, wie der
schlafende / Säugling, atmen die Himmlischen / Keusch bewahrt / In
bescheidener Knospe, / Blühet ewig / Ihnen der Geist / Und die
seligen Augen / Blicken in stiller / Ewiger Klarheit.
Doch uns ist gegeben auf keiner Stätte zu
ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings
von einer / Stunde zur anderen, / Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe
geworfen, / Jahr lang ins Ungewisse hinab.“
So hat Friedrich Hölderlin das
Gegenüber des Himmels ausgemessen, weich und schwebend das Eine, hart
und zerhackt das andere. Und das andere, das ist eben das Gegenüber
zum keuschen Schnitt der seligen
Augen, die in stiller,
ewiger Klarheit blicken, und das sind: wir.
Wir, die Menschen, das Gegenüber der Unsterblichen, die also schwinden, fallen, hinab, hinab ins Ungewisse.
Lichtjahre unterhalb jenes
Niveaus, das der bekannte Dichter aus der Zeit des Deutschen
Idealismus vorgegeben hat, hat man in der religiösen Gebrauchsmusik
meiner Generation einmal das Lied gedichtet:
„Leben, Leben wird es geben, Leben, Leben vor dem Tod.“
Immerhin, denken wir, immerhin.
Für viele, und es sind mehr als wir es sind, gilt ja auch dies nicht.
Aber es war damals auch formuliert
gegen eine Haltung, dass das Leben erst einmal kommen wird, dass es
aufzusparen sei für nachher, dann, wo alles vorbei ist. Jetzt aber, vor dem Tod haben wir das Leben im Griff, vogliamo tutto e subito,
wie man vor 40 Jahren schrie – noch einmal rufe ich die Generation
meiner Eltern um 1968 auf: tutto
e subito, alles und
sofort.
Gemessen daran, gemessen an das,
was jene einst schrieen und forderten, haben sie viel erreicht. Und
heute ist es so weit. Tutto e
subito. Wir haben nicht nur die Macht, jetzt oder wenigstens
morgen mit dem Flugzeug beinahe jedes Ziel dieser Erde anzusteuern,
wir haben auch die Macht, jetzt und sofort uns im digitalen
Datenhighway einzuloggen und diesen Globus binnen weniger Sekunden zu
einem kleinen Spielball werden zu lassen, den wir mal hier, mal dort
betippsen. Wir haben der Zeit ein Schnippchen geschlagen und wir haben
den Raum bezwungen. Wir sind mit unseren Handys immer erreichbar,
jetzt und sofort, wir
sagen, dass wir in fünf Minuten zu Hause sind, wir rufen vor der
Fleischabteilung an, welches Schnitzel wir kaufen sollen, wir sagen,
dass wir gerne den Rasen gemäht hätten, wenn: „Regnet es schon zu
Hause?“
Wir bekennen mit Stolz, dass wir
viel vom einstigen Gegenüber des Himmels verloren haben. Wir meinten
natürlich „gewinnen“, ausgesetzt einem permanenten
Wachstumsprozess, jenem drängenden Drang, die die Götter unserer
Gesellschaft vorgeben, und denen kein Politiker mehr zu widersprechen
wagt.
Das Gegenüber des Himmels wird so
potent wie nie zuvor und verglüht zugleich im Projektionswahn unserer
Endlichkeitsvorstellungen.
„Wer
gab uns die Macht, die Erde von der Sonne loszuketten? Wer gab uns den
Schwamm, den Horizont wegzuwischen? Und stürzen wir nicht fortan? Rücklings,
seitwärts, fort von allen Sonnen? Blickt uns nicht der leere Raum
an?“
Der geistige Ahnherr der Moderne,
Friedrich Nietzsche, hat in seiner bekannten Parabel „Vom tollen
Menschen“ noch diese Frage gestellt, er aber wusste noch die Höhe
des Falls zu erahnen, er wusste noch zu benennen, was wir nicht mehr können
oder auch nicht mehr wollen. Wohin also stürzen wir? Bleiben wir bei
unserem Gedanken aus dem Guckloch des stählernen Gefängnisses in der
Luft: in die Watte, den Flausch, den Schnee.
In Radstadt, das mit seinem
Festival der Paul-Hofhaimer-Tage im Bundesland Salzburg zwar nicht mit
den bekannten Reizen der Mozartstadt lockt, sondern mit den Schönheiten
seiner Natur, ist es ein leichtes sich vorzustellen, wohin man fällt,
wenn man fällt: in die samtene Decke des Schnees. Nicht nur die
Pisten, nicht nur die Dächer, nicht nur die Straßen tragen die anfänglich
leichte und dann die schwere weiße Last, auch die Gräber, die
anfangs noch Hügel markieren und nach und nach unter einer dicken weißen
Schicht gleichgemacht werden. Unter einem solchen Hügel liegt auch
meine Schwiegermutter.
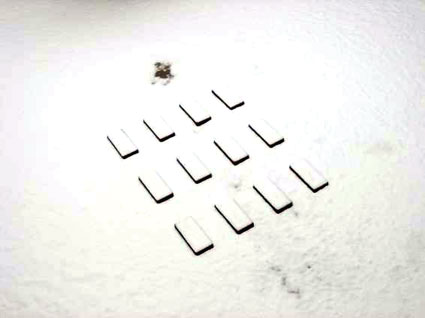
Madeleine Dietz, Wo du auch bist,
dort will ich sein, Stahlplatten, 2000/2006, Installation im Hof des
Minoritenklosters, Ausstellung in den Minoriten-Galerien Graz,
1.3.-12.4.2006, Foto: J. Rauchenberger
Wenn Sie Kinder haben, kommen diese
höchstens mit der Vorstellung zurecht, dass sie, die Oma, im Himmel
ist, wenn sie plötzlich nicht mehr zu Besuch kommt, keine Geschichten
mehr erzählt. „Die Oma soll in die Küche gehen und kochen“,
sagte mein Sohn David, als er neben ihrem Sarg im Wohnzimmer lag. Er
hat geklopft. Damals war er vier. Die Oma ist im Himmel, was wollen
Sie ihnen, Ihren kleinen Kindern, sonst weis machen? Dass sie nun ein
elektrisches Energiefeld ist, das uns im Zimmer umschwebt? Schließlich
ist ja drei Tage nach unserem Tod unser Energiefeld noch messbar.
Immerhin
- denken wir. (Nur mehr vielleicht.)
Der Mensch ist weg wie nix.
Sagte Heimito von Doderer. Das ist also noch weniger als Hölderlins
Stürzen. „Weg wie nix.“
Imagine, there is no heaven above us, no hell below us, only sky.
Wir fliegen und fliegen, wir sehen
den Schnee unter uns. Oder sind es die Wolken? Ist es die Watte? Draußen,
sagt der Kapitän durch die Lautsprecher im Flugzeug, hat es minus 48
Grad Celsius. Warum die Sonne hier nicht mehr warm ist? So mitten im sky?
Irgendwann gelangen die Strahlen
durch die Decke, irgendetwas muss sie schließlich warm machen können,
dass sie den Schnee schmelzen lassen. Auch in Radstadt. (Heuer kommt
der Sommer nicht.)
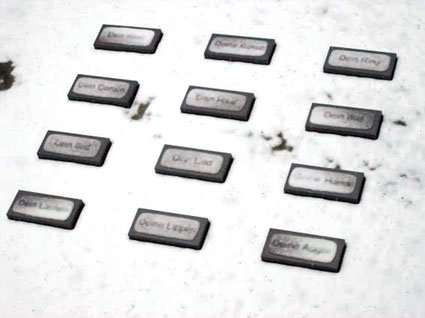
Madeleine Dietz, Wo du auch bist,
dort will ich sein, Stahlplatten, 2000/2006, Installation im Hof des
Minoritenklosters, Ausstellung in den Minoriten-Galerien Graz,
1.3.-12.4.2006, Foto: J. Rauchenberger
Der Schnee schmilzt die Gräber.
Die Sonne den Schnee.
Deine Augen – Dein Mund – Deine Haare – Dein Lachen

Deine Augen / Dein Blicken / Deine Klarheit
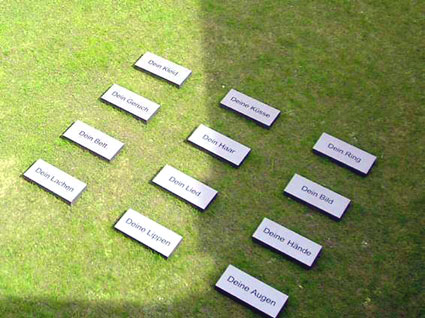
Deine seligen Augen / Blicken in stiller / Ewiger Klarheit
„Wo Du auch bist, dort will ich sein“ (Madeleine Dietz).
Die Sonne schmilzt den Schnee von
den Gräbern. Wir erwarten in diesem Jahr so sehnsüchtig Wärme. Wir
erwarten die Hitze. In Mozarts Requiem, in seinem dies
irae, dies illae ist es heiß. Die favilla
glüht noch von der Hitze. Es ist eine heiße Asche danach.
Vor zwei Jahren habe ich hier Erde
in das Grabesloch geworden. Es war kalt, die Erde gefroren. Die
Bestattung hier hatte nur wenig ungefrorene Erde, eine solche Erde war
rar. Und so haben wir einen Topf mit ungefrorener Erde geraubt, um es
ins Loch zu werfen. Der Priester sagte sein „Von
der Erde bist du genommen, dorthin kehrst du zurück“ dabei.
Genau ein Jahr später, fast
auf den Tag genau, haben wir in Graz mit Künstlern die Feuerhalle
besucht und uns mit der ganzen Prozedur der letzten Entsorgung
vertraut gemacht. Der Dichter, Arnold
Stadler, den wir eingeladen hatten, erzählte auch vom Erdewerfen
nach einer Beerdigung am Heiligen Abend. Seine Erde war gefroren; so
war es wie ein Schuss, der auf den Sargdeckel knallte, ein Projektil,
das das Holz womöglich durchdringen könnte. (Aber es ist zum Glück
nicht geschehen.)
Der Mensch ist weg wie nix.
Um zu verbrennen, braucht der
Mensch zwei Stunden. Das ist eine verdammt lange Zeit. In Graz gibt es
zwei solcher Öfen. Wir waren nicht nur im Kühlhaus, wo die Toten
noch warten, wir haben auch durch das Guckloch in das Feuer geblickt.
Da lagen sie beieinander, friedlich, sie waren schon fast fertig. Aber
sie hatten, so fühlten wir, Zeit. Zeit zu verbrennen. Die nächsten
Schritte waren nur mehr das Auskühlen, die Knochenmühle, das Abfüllen,
die richtige Nummer, zumachen, versiegeln. Das bleibt vom Menschen.
Der Rest ist in den Himmel durch den Schornstein entschwunden. In den sky
natürlich.
Imagine, there is no heaven above us, no hell below us, only sky.
Ja, das Guckloch. Was wir sahen war
– dieses Wort fiel – schön.
Und doch: Soviel wir auch sahen, wir kommen über das Sehen dem
Geheimnis nicht näher.
Aber es war etwas vom dies irae, dies illae dabei, das Sie heute Abend hören werden.
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla
Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
Und Goethe übersetzt den Tag des Zorns, den jüngsten Tag, wo die
Welt in Feuer aufgeht.
Grimm fasst dich!
Die Posaune tönt!
Die Gräber beben!
Und dein Herz,
Aus Aschenruh
Zu Flammenqualen
Wieder aufgeschaffen,
Bebt auf.
Der Mensch kann brennen. Da hat er
Zeit. Hier aber brennt nicht das Herz, es brennt die Welt. Das Ende
der Zeit wird antizipiert, der Weltzeit überhaupt. Die Welt, sie
brennt: „Solvet saeclum in favilla“. „Favilla“ ist die glühende
Asche. Der Kosmos verglüht. Anders als in den Tagen des Noe oder des
Tsunami ist es keine Überschwemmung, die die Welt zugrunde richtet
(wie wohl die Gletscher schmelzen), sondern eine Feuersbrunst.
Das haben wir alles schon gesehen, denken wir längst, das haben wir
alles schon gesehen.
Schließlich haben wir nicht nur
den Himmel säkularisiert, sondern auch das Gericht. „Es kommt, es kommt, das jüngste Gericht“, darauf hat ein
anderer Dichter, Max Frisch, in „Andorra“ vor 50 Jahren störrisch
beharrt, als er gesehen hat, dass seine Generation weiter gelogen hat,
dass sie weitergelebt haben, Täter neben Opfer, als wäre nichts
gewesen.
Heute kommt das Gericht
leichtpfotig daher. Mit smartem Anzug und schickem Kleid. In der
Gestalt der Berater, keinen Beruf – höchstens den Stand der Ärzte
– haben wir so hochbeamen lassen in den letzten Jahren wie den des
Beraters, den Unternehmensberater, die Personalentwicklung, den
Lebensberater… Wenn die Firma, in der wir arbeiten, in einer Krise
ist, kommen sie, wenn unsere Beziehung in einer Krise ist, suchen wir
sie auf. Schon wir zahlen viel, die Firmen geben Unsummen für sie
aus, nur mit der Hoffnung, im erwarteten Endgericht einer alles gleich
machenden Globalisierung noch bestehen zu können. Ihre Tätigkeit
lautet „sanieren“. Doch tun sie es nicht im Sanatorium, sondern
kommen vor Ort.
(Früher füllte die Wurzel „sanus“
das „Heilen“ aus.)
„Nachbarin! Euer Fläschchen!“ rief Gretchen. Und fiel in
Ohnmacht.

Luis Sammer, "Fürchtet euch
oder fürchtet euch nicht", (Großer Bär von Ingeborg Bachmann),
Materialobjekt, 20x100x70 cm, 2006
Doch das Fläschchen ist leer. Wir
wechseln erneut unsere Position und kehren nicht in das Flugzeug zurück,
sondern nähern uns der Sonne, die wir mit diesem jüngsten Kunstwerk
von Luis Sammer (2006) vom
Firmament nehmen und auf die vom Eis gekühlten Platten legen und
garnieren. Um sie herum die Fläschchen –
sie sind leer, ausgefahren wie Flaschenbomben. Und die orange
Halbkugel im Zentrum glänzt noch ein bisschen nach, ehe ihr Licht
bald erlöschen wird. Wir geben die Sonne als Halbkugel auf vier
Blechformen, die Kopf, Tatzen und Füße eines Bären bilden, unförmig,
wie von einer Bombe zerfetzt. Doch die orange Halbkugel ist das Herz für
die Silhouette des losgerissenen Bären, den Ingeborg Bachmann, die am
25. Juni 80 Jahre alt geworden wäre, vor genau 50 Jahren noch zügeln
wollte.
Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!
Zahlt in den Klingelbeutel und gebt
dem blinden Mann ein gutes Wort,
daß er den Bären an der Leine hält.
Und würzt die Lämmer gut.
s' könnt sein, daß dieser Bär
sich losreißt nicht mehr droht
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen
gefallen sind, den großen, geflügelten,
die aus dem Paradiese stürzten.
Dem Himmel gegenüber,
sehr geehrte Damen und Herren, sitzen wir
und essen Eis.
Der „blinde Mann“, so
glaubte die damals 30-Jährige, könnte den „Bären an der Leine
halten“. Der dichterische Ratschlag: Die Lämmer sollten wir gut würzen.
In den Klingelbeutel zahlen. Dem blinden Mann ein gutes Wort noch
geben.
(Ich weiß nicht, ob es in Radstadt
noch einen Klingelbeutel gibt.)
Wenn es noch Feuer gibt, grillen
wir die Lämmer. Wenn die Sonne erlischt, essen wir Eis wie damals,
als wir Kinder waren und unsere Eltern
uns Pfirsich-Melba als Nachspeise servierten.
Wir kehren zurück in unserer
Kapsel. Wir wechseln das Guckloch. Wir fliegen und fliegen. Unter uns
sind wieder Wolken. Oder ist es die Watte? Draußen, sagt der Kapitän
durch die knacksenden Lautsprecher, hat es minus 48 Grad Celsius.
Warum die Sonne hier nicht mehr warm ist?
Es ist Zeit zu landen. Es ist Zeit,
den sky zu verlassen – und
in den Himmel zu kommen.
Wir stürzen
nicht mehr, wie Hölderlin sagte, nein, wir landen sanft mit unserem
tonnenschweren Käfig.
Wir landen im Königreich. Wir
erwarten den heaven.
Wir steigen aus, geordnet wie es
die Stewardess wünscht. Wir passieren die Gepäcksschleife und warten
auf unsere Habseligkeiten, wir sind bald hinter dem Zoll, bald in der
Ankunftshalle eines Flughafens. Wir stehen vor der Schwelle zum Königreich,
der „Threshold to The
Kingdom“ (Mark Wallinger). Noch trennt uns die Zolltür. Sie öffnet
sich automatisch, wenn wir durch sie durchtreten wollen. Wir gehen
hinaus – oder wir gehen hinein, das ist eine Frage der Sichtweise.
Wir gehen allein, als Geschäftsreisende, privat; in Gruppen, als
Paare, Familien, Flugpersonal... Manche gehen zielsicher ihren Weg.
Manche von uns werden erwartet, manche begrüßt, manche umarmt,
manche gehen allein. Wir gehen in extremer Zeitlupe, wir wissen, dass
hier eine andere Zeit herrscht. Eine andere Zeit als wir es bisher
gewohnt waren, Zeit zu erfahren. Wir erinnern uns sogar, dass unser
Hinaustreten wie eine Choreografie wirkt. Vielleicht hat man mit uns
auch geübt.
Wir wechseln die Dimension.
An der Zolltür sitzt Petrus. Und
wir singen nicht, wie Alois Hingerl, Halleluja,
sondern:
„Miserere Mei, Deus: secundum magnam
misericordiam tuam. …“ - „Herr, sei mir Sünder gnädig, gemäß
deiner großen Barmherzigkeit (Psalm 51)“

Mark Wallinger, Threshold To The
Kingdom, Video, 2002. Courtesy The Artist und Anthony Reynolds Gallery
London
… Et secundum multitudinem miserationum
tuarum: dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est
semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in
sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me
mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiæ tuæ
manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et lætitiam: et exultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus
meis.
Ne projicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi lætitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ: et exsultabit
lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies: et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non
delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum,
Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: ut ædificentur muri
Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes et holocausta: tunc
imponent super altare tuum vitulos.
(Dem Himmel gegenüber, meine Damen und Herren, ist eine Tür für die
Schwelle ins Reich, der Threshold To the Kingdom – diese Vision
verdanken wir dem britischen Kunststar Mark Wallinger, dessen Galerie
in London mir dieses Kunstwerk, das erstmals auf der Biennale in
Venedig 2001 zu sehen war, für
diesen Vortrag der Paul-Hofhaimer-Tage zur Verfügung gestellt hat und
das heute in der betörenden Untermalung von Allegris Miseree erstmals
live aufgeführt wurde, vom Schwantaler Vokalensemble unter der
Leitung von Bernhard Schneider. Allegri hat diesen Psalm 51, den
bekannten Bußpsalm für die Liturgie der Karwoche komponiert.)
Johannes Rauchenberger, Kunsthistoriker und Theologe (MMag. Dr.),
Kurator internationaler Ausstellungen zeitgenössischer Kunst (wie
etwa „Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft“), ist Leiter
des Kulturzentrums bei den Minoriten in Graz und Lektor für Religion
in der Kunst der Gegenwart an der Universität Wien.
www.minoritenkulturgraz.at
Augustinus, SERMO 252, IN DIEBUS PASCHALIBUS
|